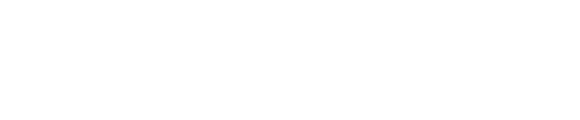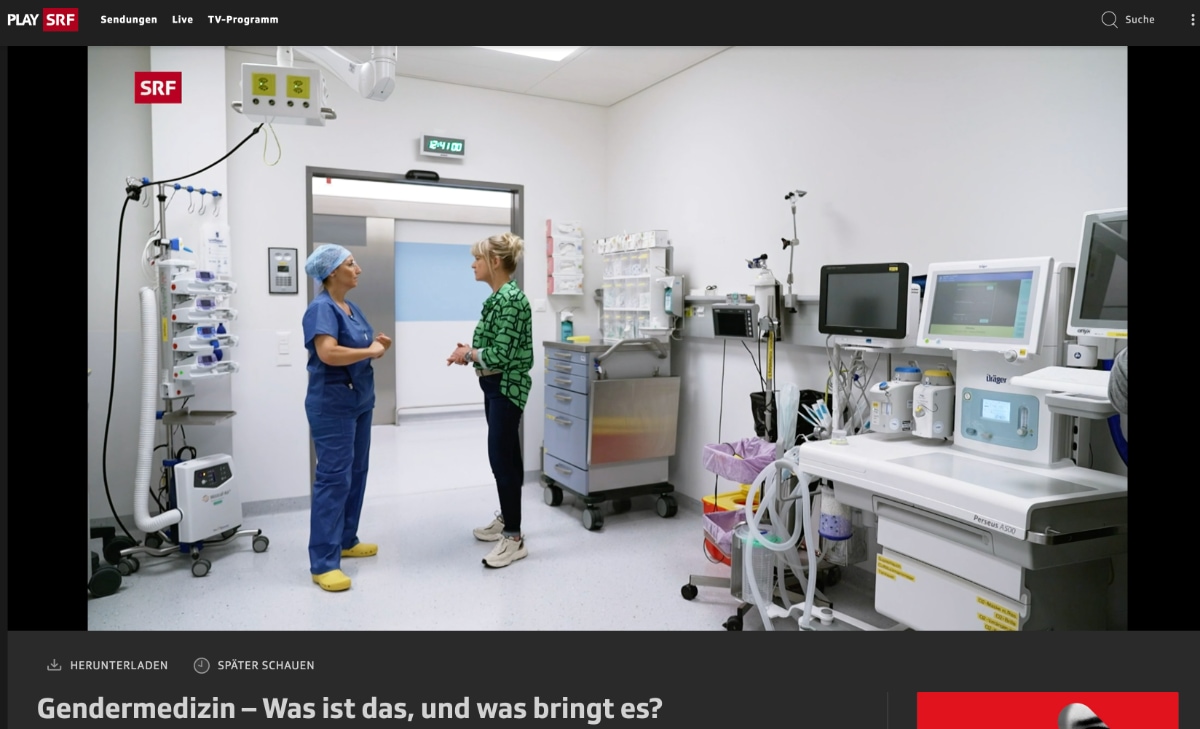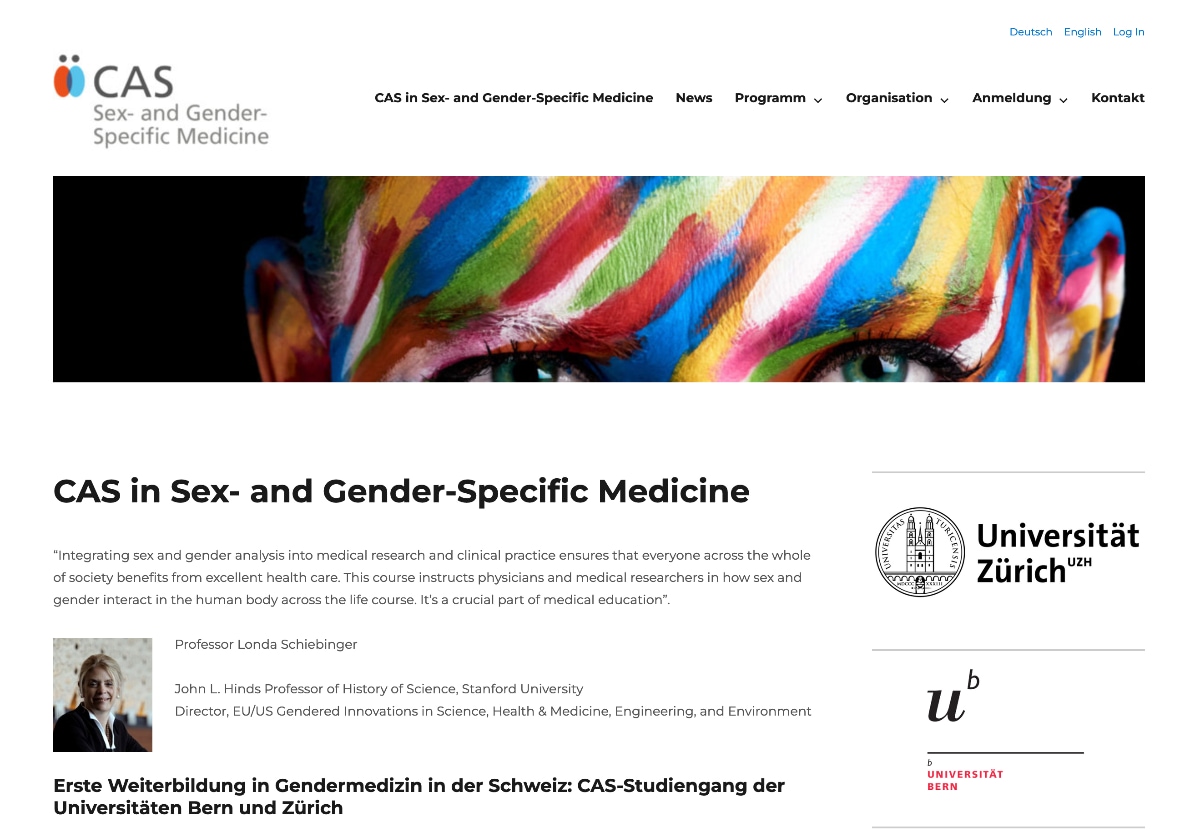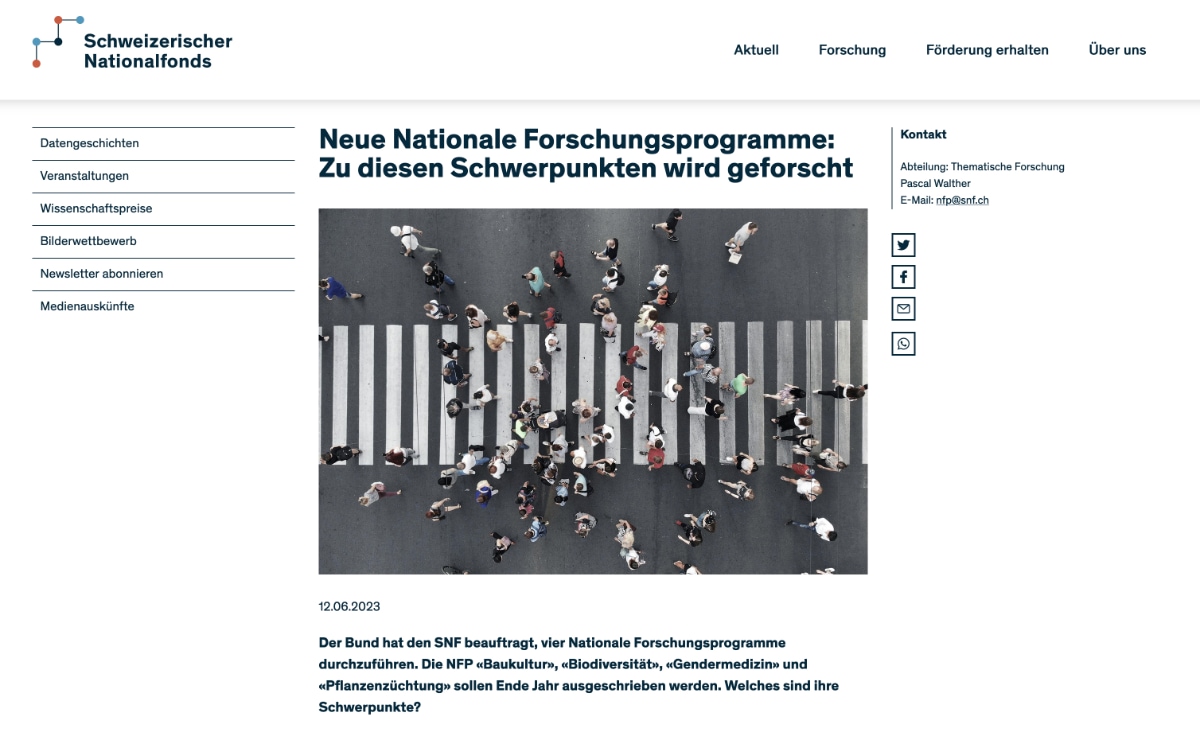Gendermedizin im Alltag – Wie gross ist das Verständnis?
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2PULS TV-Sendung vom 11.09.2023, 31 Min https://www.srf.ch/play/tv/puls/video/gendermedizin—was-ist-das-und-was-bringt-es?urn=urn:srf:video:e81657c9-70ec-488b-803a-5fc5f28c5784
Was ist eigentlich Gendermedizin? Chirurgin Diana Mattiello und Assistenzarzt Rubén Fuentes vom Spital Limmattal kennen die Antwort. Sie absolvieren eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema Gendermedizin. Dabei stossen sie bei Kolleginnen und Kollegen auch auf Unverständnis und Vorurteile, wie sie im Interview mit Daniela Lager erzählen.
Lebensgefährliche Stereotype – Zwei Frauen erzählen
Olga Duarte und Sandrine Dumont wären beide beinahe gestorben. Sie erkannten alarmierende Krankheitssymptome nicht und mussten in der Folge notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Befund: Herzinfarkt. Die Geschichten der beiden Frauen stehen exemplarisch für das Unwissen über geschlechtsspezifische Erkrankungen und damit zusammenhängende Stereotype.
/
Universitäten Bern und Zürich bieten neu Weiterbildung zu geschlechtsspezifischer Medizin an
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2Die Universitäten Bern und Zürich bieten neu einen gemeinsamen CAS Weiterbildungsstudiengang zu geschlechtsspezifischer Medizin an. Das Ziel ist es, Schweizer Ärztinnen und Ärzte bezüglich der geschlechtsspezifischen Medizin zu sensibilisieren, die individuelle Behandlung von Patientinnen und Patienten zu verbessern und die entsprechende Forschung voranzutreiben. In insgesamt elf Modulen werden ab Mai 2020 geschlechtsspezifische Aspekte in den unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen sowie in der medizinischen Forschung aufgezeigt und diskutiert. Die Referierenden – Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland – werden den Teilnehmenden die neueste Evidenz in den verschiedenen Bereichen aufzeigen, aber auch allfällige Forschungslücken und ihre Konsequenzen im klinischen Alltag. Mehr dazu finden Sie unter www.gender-medicine.ch.
/
Frau Prof. Beck Schimmer im Interview mit Frau Zeindler
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2In einem Interview mit Frau Zeindler erklärt Frau Prof. Beck Schimmer (Direktorin Universitäre Medizin an der Universität Zürich) die Bedeutung der Geschlechterunterschiede in der Medizin und warum die Geschlechterperspektive in der Forschung für uns Frauen überlebenswichtig ist. Sie zeigt auch auf, wie durch ein verändertes institutionelles Umfeld eine Professur – gerade auch für Frauen – an Attraktivität gewinnen kann.
/
Gendermedizin – warum Frauen eine andere Medizin brauchen
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2Prof. Dr. med. Dr. h.c. Vera Regitz-Zagrosek, Dr. med. Stefanie Schmid-Altringer
Frauen und Männer sind nicht gleich, aber sie sollten in der Medizin wie auch sonst in der Gesellschaft gleichberechtigt und gleich gut behandelt werden. Was sich so selbstverständlich anhört, ist noch längst nicht in der tagtäglichen Gesundheitsversorgung angekommen. Um Frauen und Männer gleich gut zu behandeln, muss man ihre Ungleichheit anerkennen und ganz konkret erforschen. Die moderne, junge Disziplin der Gendermedizin, die sich bei uns in Europa seit der Jahrtausendwende entwickelte, hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Dieses Buch erläutert die Grundlagen und Anwendungen der Gendermedizin verständlich für Nicht-Mediziner*innen.
Die Medizin konzentriert sich auch heute noch auf scheinbar geschlechtslose „Patienten“. Dabei ist in den Lehrbüchern jedoch der Mann der Prototyp und das Maß aller Dinge. Aber: Frauen und Männer unterscheiden sich in ihrer Biologie grundlegend – jede Zelle, gleich ob Hirn-, Herz-, oder Leberzelle ist, wie wir heute wissen, bei Frauen und Männern unterschiedlich – und diese Unterschiede bestimmen oft den Verlauf von Erkrankungen. Dennoch ignoriert die medizinische Forschung den Unterschied zwischen den Geschlechtern weitgehend.
Der typische Studienteilnehmer in der Arzneimittelforschung ist ein Mann, und Tierversuche werden vor allem an jungen männlichen Versuchsmäusen vorgenommen. Für sie werden Medikamente entwickelt sowie deren Wirkungen, Nebenwirkungen und Sicherheit getestet. Tests an weiblichen Mäusen werden zu wenig gemacht, weil die Forscher befürchten, dass der Zyklus der Mäuseweibchen die Ergebnisse der Experimente beeinflussen könnte. Und in die klinischen Studien werden oft weniger Frauen eingeschlossen, da man Probleme bei möglichen Schwangerschaften fürchtet. Das Ergebnis sind dann Medikamente, deren Dosierungen nicht an Frauen, ihre Körper, an ihre Hormonsituation angepasst wurden.
Noch in den 1990er-Jahren wussten Ärzt*innen nicht, dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen oft anders zeigt als bei Männern, wodurch oft wertvolle Zeit verschenkt wurde. Auch heute noch denken viele Frauen und Ärzt*innen bei Symptomen wie Luftnot und starker Übelkeit bei Frauen nicht an einen Herzinfarkt und Betroffene werden deshalb zu spät behandelt. Noch immer kommen Frauen mit Herzinfarkt später in die Notaufnahme als Männer, auch wenn der Unterschied geschrumpft ist.
Frauen kennen ihre Gesundheitsrisiken schlechter als Männer, nicht nur bei Herzerkrankungen, sondern in allen Bereichen: Lungen, Nieren, Muskel, Skelett, Stoffwechsel, Hirn und Gefäßerkrankungen, bei Depressionen und Stress. Sie wissen nicht, was gefährlich für sie ist, und was sie ihre Ärzt*innen fragen sollen, um ihre Erkrankungen und die Empfehlungen für Arzneimittel oder Operationen besser zu verstehen. Hier will dieses Buch helfen, indem es die Geschlechterunterschiede bei wichtigen Erkrankungen, ihre Grundlagen und die Folgen verständlich erläutert.
Gendermedizin kann Leben retten oder Gesundheit verbessern, wenn sie in der Praxis angewandt wird. Genau das will dieses Buch erreichen.
Es existiert als Hardbook aus 2020 und als Taschenbuch 2021 mit einem Update zu COVID
2020:
https://scorpio-verlag.de/Buecher/341/GendermedizinWarumFraueneineandereMedizinbrauchen.html
2021:
https://www.scorpio-verlag.de/Buecher/404/ScorpioPocketDieXXMedizin.html
/
Gendermedizin seit anfangs Juni 2023 im NFP
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2gGendermedizin wurde anfangs Juni 2023 ins NFP aufgenommen. Das Nationale Forschungsprogramm «Gendermedizin und Gesundheit» (NFP 83) ist mit 11 Millionen Franken dotiert. Es schafft eine Wissensbasis für den Einbezug von Geschlechter- und Genderaspekten in die medizinische Forschung und die Gesundheitsversorgung. Das NFP will zu einem Kulturwandel beitragen und Standards erarbeiten. Zudem soll es Ausgangspunkt sein für eine langfristig ausgerichtete Forschung in der Gendermedizin. Das NFP untersucht unter geschlechter- und genderspezifischer Perspektive vier Schwerpunkte:
- Gesundheitsversorgung und Prävention.
- Medizinische Behandlungen und Therapien.
- Wirkmechanismen in der Medizin und der öffentlichen Gesundheit.
- Soziale und gesellschaftliche Auswirkungen.
Die Forschung in diesem NFP verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, bei dem Forschende aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenarbeiten. Themenübergreifende Kooperationen mit der Praxis sind für den Erfolg des Programms von entscheidender Bedeutung.
/
Vision für den Medizinstandort Zürich – Gendermedizin – Bericht von Nathalie Zeindler
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2Ein erster Schritt in Richtung individualisierter Medizin (Präzisionsmedizin) ist die Berücksichtigung von Geschlechtsunterschieden (Gendermedizin). Während im Zeitalter Präzisionsmedizin bereits Therapiekonzepte auf einzelne Gene abgestimmt werden, wird der Unterschied zwischen Mann und Frau in der klinischen Routine kaum wahrgenommen. Das Geschlecht spielt medizinisch eine wichtige Rolle.
Am 24. Januar haben FemaleShift und die Universität Zürich zu einer gemeinsamen Veranstaltung zum Thema «Gendermedizin» im Restaurant UniTurm in Zürich eingeladen.
Gesprächsteilnehmer
Prof. Beatrice Beck Schimmer, Direktorin UMZH Universität Zürich
Prof. Catherine Gebhard, leitende Ärztin Kardiologie Inselspital BE
Prof. Vera Regitz, Konsiliarärztin für Kardiologie, UZH
Prof. Gregor Zünd, CEO Universitätsspital Zürich
Gesprächsleitung: Dr. Esther Girsberger
Beim anschließenden Umtrunk hat das zahlreich erschienene Publikum die Gelegenheit zu einem regen Austausch genutzt. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.
Bericht von Nathalie Zeindler
Die personalisierte Medizin beschäftigt das Zürcher Universitätsspital seit geraumer Zeit mit dem damit verbundenen Ziel, Patientinnen und Patienten eine möglichst präzise Diagnostik, passende Therapien und dadurch eine verbesserte Lebensqualität anbieten zu können.
Nach wie vor wird diesem Aspekt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Forschung muss entsprechend vorangetrieben werden», erklärte Prof. Gregor Zünd, CEO Universitätsspital Zürich, im Rahmen des von Dr. Esther Girsberger moderierten Informationsanlasses an der Universität Zürich.
Im Jahr 2024 wird diese einen neuen Lehrstuhl für Gendermedizin einberufen, um Geschlechterunterschiede zu erforschen und einzubringen in Lehre und Praxis.. Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz diesbezüglich hinterher. Man wolle sich künftig jedoch gut positionieren, versprach Prof. Zünd.
Die hart erkämpfte Professur wurde dank des beharrlichen Einsatzes von Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer, Direktorin UMZH, Universität Zürich und Prof. Cathérine Gebhard, Leitende Ärztin Kardiologie Inselspital Bern sowie Stiftungen ermöglicht.
Innovation bedeutet auch, neues Terrain zu beschreiten. Es handelt sich um eine Vision für den Medizinstandort Zürich bestehend aus einem grossen Netzwerk. Dazu gehören die vier universitären Spitäler Balgrist, das Kinderspital, das Universitätsspital sowie die Psychiatrische Universitätsklinik – eine enge Zusammenarbeit, die ein umfassendes Angebot im Bereich der Spitzenmedizin beinhaltet.
«Der medizinische Standort Zürich soll sich zu einem Leuchtturm mit Fokus auf die Präzisionsmedizin in der Schweiz und darüber hinaus entwickeln. Allzu lange ist übersehen worden, dass sich Frauen von Männern unterscheiden und bei bestimmten Krankheiten andere Symptome aufweisen sowie eine andere Medikamentendosierungen brauchen, sagte Prof. Beatrice Beck Schimmer. Eine unpassende Dosierung oder Krankheiten, die man lediglich einem bestimmten Geschlecht zuordnet, haben weitreichende Folgen und führen dazu, dass beispielsweise die Osteoporose, die vorwiegend mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht wird, bei Männern zu spät oder nicht erkannt wird.
Einen umso wichtigeren Platz nimmt die Forschung ein und dazu gehört, in die Ausbildung von Studierenden zu investieren sowie das erworbene Wissen in die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zu integrieren.
Prävention und passende Therapien sind von grosser Bedeutung für die Gesellschaft, denn bei einer falschen Dosierung muss vermehrt mit Nebenwirkungen gerechnet werden, was nicht nur zusätzliche Konsultationen, sondern auch höhere Gesundheitskosten mit sich bringt.
Die Universität Zürich wagt mit dem ersten Gendermedizin Lehrstuhl einen hoffnungsvollen Schritt. Das Berufungsverfahren läuft bereits, und im Rahmen eines öffentlichen Symposiums präsentierten sich bereits internationale Kandidatinnen und Kandidaten einem interessierten Publikum.
Prof. Vera Regitz-Zagrosek. Kardiologin und Pionierin der Gendermedizin, wies auf die zentrale Bedeutung des künftigen Lehrstuhls hin und fügte ein konkretes Beispiel an:
«Um spezielle diagnostische Schritte einzuleiten, sollte eine Frau mit Oberbauchbeschwerden nicht zunächst einer Magenspiegelung unterzogen und später noch zu einem Psychiater geschickt werden, bevor sie in die Kardiologie weiterverwiesen wird. Das zeigt, wie wichtig es ist, genau zu wissen, worauf Beschwerden zurückzuführen sind.» Es gelte, Wissen zu generieren und ein dazugehöriges Institut zu eröffnen sowie eine Assistenzprofessur zu ermöglichen, welche die Forschung tatkräftig unterstützt.
Allerdings lassen Forschungsergebnisse laut Prof. Cathérine Gebhard noch zu wünschen übrig: «Die Forschung ist über die letzten Jahrzehnte immer weniger bahnbrechend geworden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob wir nicht mehr kreativ genug und risikobereit sind.» Tatsache ist, dass die meisten Daten an männlichen Tieren erhoben werden, und noch immer ist unter anderem ungenügend erforscht, weshalb Männer schwerer an Corona erkrankt sind als Frauen. Zwar existieren einige Hypothesen, aber wenig Grundlagenforschung. Die soziokulturellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurden genauer unter die Lupe genommen in Bezug auf das Gesundheitsverhalten und Krankheitsfälle. Geschlechterunterschiede spielten allerdings keine Rolle mehr, sobald die Patientinnen und Patienten hospitalisiert werden mussten. Noch liegen die Gründe hierfür im Dunkeln.
Hingegen waren Frauen stärker von Post-Covid betroffen. «Dabei zeigte sich, dass die Stressbelastung eine wichtige Rolle spielt ebenso wie die Einsamkeit, welche nicht selten alleinerziehende Mütter betrifft», so Prof. Cathérine Gebhard. Unbestritten ist: Frauen reagieren empfindlicher auf emotionalen Stress, was auch das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht, da das Angstzentrum des Gehirns tangiert wird. Neueste Technologien wie genetische Analysen und künstliche Intelligenz dürften dabei helfen, die Geschlechterunterschiede künftig besser zu erforschen und die Gendermedizin voranzutreiben. Diese gilt als Querschnittsfach, weshalb der Interaktion zwischen den verschiedenen Disziplinen insbesondere auch im Bereich der Soziologie eine besondere Bedeutung zukommt.
/
Gendermedizin
0 Kommentare/von N7zH53bA7Rb2a2Ein erster Schritt in Richtung individualisierten Medizin (Präzisionsmedizin) ist die Berücksichtigung von Geschlechtsunterschieden (Gendermedizin).
/
Geschäftsstelle
Suter Howald Rechtsanwälte
Räffelstrasse 26
Postfach
CH-8021 Zürich